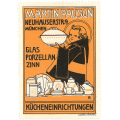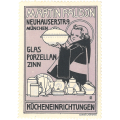Wahrscheinlich entstand bereits im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts, als München durch den neuen Markt ("forum apud munichem") einen wirtschaftlichen Aufschwung nahm, die erste jüdische Gemeinde. Mit herzoglicher Erlaubnis wurde 1210 eine Synagoge oder Betsaal angelegt. Eine Urkunde aus Regensburg erwähnt 1229 einen Münchner Juden erstmals mit Namen: "Abraham de Municha". Am 12. Oktober 1285 nahm diese Gemeinde mit rund 300 Mitgliedern ein grausames Ende, als nach einem Ritualmordvorwurf 67 Männer – wohl sämtliche Haushaltvorstände – in der Synagoge eingesperrt und lebendig verbrannt wurden. Doch bereits im Jahr 1287 siedelten sich unter dem Schutz der Herzöge neue jüdische Familien an und bauten ihr Gotteshaus wieder auf.
Das jüdische Viertel entstand zwischen der Weinstraße und Dienerstraße auf dem heutigen Marienhof. Es lag bereits damals an einer "Judengasse", obwohl der Name erst 1380 archivalisch nachweisbar wird. Vereinzelt sind Wohnungen außerhalb dieses Bereiches nachgewiesen. Eine Randlage im Schutz der herzoglichen Macht (Alter Hof), dennoch nahe genug am wirtschaftlichen Zentrum (Marienplatz und Rindermarkt): Diese geradezu typische Situation entspricht den anderen Wittelsbacher Gründungen Dingolfing, Friedberg, Landsberg, Landshut und Straubing.
Die gesamte Landjudenschaft des (ober-)bayerischen Herzogtums, inklusive der Münchner Gemeinde, zahlte dem herzoglichen Vitztumsamt 1291 ein großes Schutzgeld: 90 Pfund schwarze und 100 Pfund weiße Haller Pfennige. Im Jahr darauf waren es sogar 340 Pfund verschiedener Prägung. Als 1293 überall im Land Juden festgesetzt wurden und allein in Dachau zwei jüdische Händler 400 Pfund Regensburger Pfennige als Lösegeld aufbringen mussten, da hatten die in München inhaftierten Juden für ein juristisches Gutachten "nur" 30 Pfund zusätzlich zu den sonst üblichen 10 Pfund an das Vitztum zu bezahlen. Es würde jedoch zu weit gehen, daraus auf eine bevorzugte Stellung zu schließen.
Ludwig IV. der Bayer (reg. 1314–1347) gewährte nach dem Augsburger Vorbild das Judenrecht von München. Es garantierte freie Religionsausübung, Selbstverwaltung sowie die Befreiung von städtischen Lasten wie dem Wehr- und Wachdienst, enthielt jedoch keine politischen Bürgerrechte. Wenig später, am 20. August 1315, verpfändete Ludwig seine Münchner Steuereinnahmen für mehrere Jahre an die Juden in Augsburg.
Die ältesten Ratssatzungen jener Zeit übernahmen aus dem Schwabenspiegel das Marktschutzrecht für jüdische Geldhändler mitsamt den Regularien für verpfändete Nutztiere. Bis 1337 wurde München durch einen zweiten Mauerring um das sechsfache seiner Größe auf rund 90 Hektar erweitert. Dadurch rutschte die "Judengasse" vom Rand in das Zentrum der Stadt.
Das Stadtrecht von 1340 enthält ebenfalls Vorschriften im Bezug auf die jüdische Bevölkerung: Der Zins wurde auf wöchentlich 2 Pfennige für Bürger und drei Pfennige für Ortsfremde festgelegt. Bei Krediten ohne Pfand sollten jüdische Bankiers auf einen rechtsgültigen, gesiegelten Pfandbrief bestehen. Juden durften die Ware auf dem Fischmarkt vor dem Kauf nicht berühren, die Fischer hingegen wurden bestraft, wenn sie während der Osterzeit Fisch in ein jüdisches Haus lieferten. Eine Fleischordnung nach dem Vorbild der Reichsstadt Nürnberg legte fest, dass kein christlicher Metzger sein Fleisch an Juden verkaufen durfte. Alles koscher geschlachtete oder zerlegte Fleisch musste als solches ausdrücklich gekennzeichnet sein und wurde ausschließlich auf der "hinteren Bank am Steg" (Roßschwemmbach) verkauft. Die jüdische Gemeinde zahlte um 1340 jährlich 60 Pfund Pfennige Schutzgeld, was auf 20 bis 25 eigenständige Haushaltungen schließen lässt.
In seiner Residenzstadt München führte Kaiser Ludwig IV. am 3. Februar 1342 den sogenannten Opferpfennig als weitere Sondersteuer für alle Juden im Heiligen Römischen Reich ein; diese direkte Kopfsteuer wurde bis zur Auflösung des Reiches im Jahr 1806 erhoben. Das Rechnungsbuch des oberen Viztumsamtes verzeichnet einige Geldhändler als Pfandnehmer, ansonsten finden sich bis 1345 nur wenige Nachrichten über jüdisches Leben in der Stadt. Während der der europaweiten Pestpogrome 1348/49 gehörten laut dem Nürnberger Memorbuch auch Mitglieder der Münchner Gemeinde zu den Opfern: Sie wurde beinahe oder sogar vollständig ausgelöscht, die Stadtchronik schweigt darüber.
Herzog Ludwig V. der Brandenburger (reg. 1347–1361) genehmigte schon 1352 die erneute Ansiedlung von Schutzjuden in seiner Residenzstadt, weil sie für das Wirtschaftsleben unentbehrlich erschienen: "Von des gebrechen wegen, der ueberall in unserem land gewesen ist under reichen und armen uomb gelt seit der zeit, als die juden verderbt sind". Der städtische Magistrat konnte den Zins, den jüdische Bankiers von ihren Kunden maximal nehmen durften, im Jahr 1372 auf 43 ½ Prozent für Bürger und 65 Prozent für Ortsfremde ermäßigen. Innerhalb des Münchner Burgfriedens war den ansässigen Juden nur das Kredit- und Geldgeschäft, Vieh- und Fleischhandel sowie eine koschere Metzgerei nach der Nürnberger Fleischordnung gestattet.
Im Jahr 1380 stiftete (oder verkaufte?) ein "Sanbel Hainrich Stupf" der Kehillah sein Anwesen mit dem Hausnamen "Schneeberg". Zunächst bezogen "Judenmeister" Jakob und sein Sohn Abraham das Haus an der Nordseite der Judengasse, später konnte die Gemeinde darin eine neue Synagoge einrichten. Zu dieser Zeit wurde auch der Straßenname erstmals aktenkundig. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wohnten 115 Juden in München. Im Jahr 1400 erschienen Vertreter der Gemeinde vor dem versammelten Inneren und Äußeren Rat der Stadt: Sie hätten sich – so der Text im Ratsbuch IV – untereinander beraten und erklärten nun feierlich, sich ganz auf das Kreditgeschäft beschränken zu wollen, "als juden von recht tun süllen", und auch bei der Wahl der Pfänder Zurückhaltung zu üben, "der stat armen und reichen das zu lieb und für ein recht". Verstöße ahndete das Rabbinatsgericht mit einer Strafzahlung von 10 Gulden für die Stadtkasse.
Es kam 1413 zu einem erneuten Pogrom in München, über das aber fast nichts bekannt ist. Rund drei Jahrzehnte später ließ Herzog Albrecht III. der Fromme (reg. 1438–1460) alle Juden 1442 aus seinem Herrschaftsgebiet ausweisen, vornehmlich um sich an ihrem Vermögen zu bereichern. Die Synagoge wurde anschließend zur "Gruftkirche" umgebaut, die Judengasse zur Gruftgasse. In den kommenden hundert Jahren lebten zwar wieder einige jüdische Familien in München, aber es waren stets zu wenige, um eine neue Gemeinde (Kehillah) gründen zu können. Die Bayerische Landordnung von 1553 verbot ihnen generell den Aufenthalt in allen Teilen des Herzogtums und damit auch in der Residenzstadt.
Mit einer Sondererlaubnis zog im Jahr 1726 der kaiserlich-kurfürstliche Hoffaktor Wolf Simon Wertheimer (1681–1765) mit seiner Familie nach München. Sie mieteten sich im Rückgebäude des Anwesens Plan-Nr. 161 (heute Tal 13) ein. Das Haus gehörte zu einer Gastwirtschaft mit Schanklizenz für Branntwein, um 1778 wird sie in Quellen "Zum Judenbranntweiner" genannt. Die Aufenthaltsgenehmigung für Wertheimer war ein Präzedenzfall, außerdem zog sein Einfluss einige weitere privilegierte jüdische Geschäftsleute und deren Familien an. Noch war jüdisches Leben in München, dem "Deutschen Rom", beileibe keine Selbstverständlichkeit: Als der Gastwirt Hillebrandt seinem prominenten Mieter im Jahr 1729 gestattete, mit seiner Familie und einigen Glaubensgenossen das Laubhüttenfest zu feiern, wurde er denunziert. Ihm drohte eine Körperstrafe und der Verlust seiner Gastwirtschaft. Mit einer Direktive an den Magistrat milderte Kurfürst Karl Albrecht von Bayern (reg. 1726–1745) diese Strafe "gnadenhalber" in eine Zahlung von 100 Dukaten ab. Schließlich bezahlte Wertheimer das Geld, um seinen Hauswirt vor dem Ruin zu bewahren. Nach Aufhebung des allgemeinen Aufenthalts- und Gewerbeverbots für jüdische Hoffaktoren bildete sich ab 1750 in München eine kleine "Hoffaktorengemeinde" (Claudia Prestel) aus 20 Jüdinnen und Juden. Sie feierten ihre Gottesdienste in einem Betsaal, den Wolf Wertheimer im Obergeschoss seines Wohnhauses zur Verfügung stellte. Der Ehrentitel "Rabbi[ner]" auf Wertheimers Grabstein in Augsburg-Kriegshaber lässt darauf schließen, dass er auch in religiösen Dingen eine führende Rolle einnahm.
Im erneuerten Straf- und Zivilrecht des Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis 1755/56 wurden alle unprivilegierten Jüdinnen und Juden auch weiterhin massiv diskriminiert, das Niederlassungsverbot aus dem 16. Jahrhundert blieb unverändert in Kraft. Rund ein Vierteljahrhundert später regierte Karl Theodor von Kurpfalz-Bayern (reg. 1777–1799) und genehmigte im ersten Jahr seiner Herrschaft den weiteren Zuzug von Juden nach München. Die Gemeinde wuchs dadurch bis 1790 auf 127 Personen an. Mit der Besetzung und Eingliederung der linksrheinischen Kurpfalz in den französischen Staat während des Ersten Koalitionskriegs erhielten die dortigen Juden ab 1797 volle Bürgerrechte, während in den übrigen Wittelsbacher Territorien alles noch einige Jahre unverändert blieb.
Das "Münchner Judenregulativ" (17. Mai 1805) erschwerte die weitere Niederlassung von Juden in München. Kurfürst Maximilian IV. Joseph (reg. 1799–1826), der sich schon im nächsten Jahr als Maximilian I. zum König von Bayern ausrufen ließ, etablierte für das Stadtgebiet eine Matrikelliste sog. "Schutznummern". Er beschränkte noch einmal die Gewerbemöglichkeiten und setzte das Darlehensgeschäft stärkeren Kontrollen aus. Dafür garantierte der Kurfürst aber auch zum ersten Mal verbindliche Aufenthalts-, Niederlassungs- und Handelsrechte. Während 70 jüdische Familien ein Bleiberecht erhielten, mussten 37 Familien die Residenzstadt wieder verlassen. 1804 erhielten die jüdischen Kinder die Erlaubnis, christliche Schulen zu besuchen. Das Bayerische Judenedikt von 1813 gewährte den bayerischen Jüdinnen und Juden endlich Bürgerrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, Religions- und Gewerbefreiheit, verpflichtete aber auch zur Annahme von Familiennamen und legte mittels sogenannter Matrikellisten die Gesamtzahl jüdischer Haushalte fest.
Die jüdische Gemeinde bestand weiterhin aus privilegierten, überwiegend hofnahen Familien. Ihre gesicherte Stellung äußerte sich auch in einem repräsentativen neuen Gotteshaus. Der Grundstein für die klassizistische Synagoge wurde 1824 unter König Max I. Joseph gelegt, zur Einweihung am 21. April 1826 kamen sein Nachfolger Ludwig I. und dessen Gemahlin, Königin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Eine eigens von der jüdischen Gemeinde geprägte Medaille enthält auch einen Segenswunsch für das bayerische Königspaar: "Gott erhalte Sie lange!". Noch im gleichen Jahr erschienen die offizielle Synagogenordnung und eine Festrede von Hirsch Aub (1796–1875) im Druck. Als Rabbiner und Religionslehrer betreute Aub über 45 Jahre lang die Münchner Kultusgemeinde. Er behielt im zunehmend schärfer ausgetragenem Streit zwischen Reform und Orthodoxie eine ausgleichende Position. Dadurch konnte er noch für vergleichsweise lange Zeit die Einheit der Gemeinde bewahren. Zu den bedeutenden jüdischen Persönlichkeiten Münchens im frühen 19. Jahrhundert zählen Israel Hirsch Pappenheimer (1777?–1837), ein Vorkämpfer der Emanzipation, die Hofbankiers Aron Elias Seligmann von Eichthal (1747–1824), Jakob von Hirsch auf Gereuth (1765–1840) und Heinrich Sigmund Pappenheimer von Kerstorf (1769–1832), aber auch kurzzeitige Gäste wie der berühmte Dichter Heinrich Heine (1797–1856).
In die "Schönheitengalerie" König Ludwigs I. (reg. 1825–1848) im Schloss Nymphenburg wurde 1829 als "schönste Jüdin Münchens" die damals 17-jährige Nanette Kaulla (1812–1876) aufgenommen, Tochter des Hoffaktoren und Gemeindevorstands Jacob Raphael Kaulla. Für viele liberal oder gar säkular denkende jüdische Familien aus besseren Kreisen war die Konversion zum Christentum eine Möglichkeit, um sozial aufzusteigen. Sehr oft übernahmen hochgestellte Persönlichkeiten die Patenschaft, was die Karrieremöglichkeiten und den Heiratsmarkt deutlich erweiterte. Ein Beispiel ist Caroline Barbara Kirchberger (1798–1869), Tochter des "Jubellen- und Antikenhändlers" Simon Ullmann, die sich katholisch taufen ließ – zum Paten stand der Hofzeremonienmeister Graf Carl von Rechberg – um den hofnahen Porzellanmaler Franz Xaver Nachtmann (1798–1846) heiraten zu können.
Nach Abschaffung der Matrikellisten im Jahr 1861 hatten die jüdischen Bayerinnen und Bayern ihre volle Freizügigkeit erhalten, besaßen also freie Wohnorts- und Berufswahl. Mit der neuen gesamtdeutschen Reichsverfassung von 1871 wurden sie endgültig zu gleichberechtigten Staatsbürgern. Durch diese positive Entwicklung beschleunigte sich jedoch der Niedergang des traditionellen Landjudentums, weil vor allem junge Generationen bessere Bildungs- und Berufschancen in urbanen Zentren suchten. Die jüdische Bevölkerung in München wuchs rasant an und spielte im kulturellen, wirtschaftlichen sowie politischen Leben der Stadt eine wichtige Rolle.
Mit zunehmendem Fremdenverkehr stieg ab den 1880er Jahren der Bedarf an Bierkrügen als Andenken und Sammelobjekt. Ihre "Veredelung" lag bis zur NS-Diktatur fast ausschließlich in jüdischen Händen: Die Produkte der Firmen Löwenstein, Mayer, Thannhauser und Pauson prägten das werbewirksame Bild einer "Bier- und Kunststadt". Es ist zwar nur eine Legende, dass der junge Albert Einstein (1879-1955) mit seinem Vater die erste elektrische Beleuchtung auf dem Oktoberfest installierte, allerdings verbrachte er seine gesamte Kindheit und Schulzeit in München. Im Jahr 1884 übernahm der jüdische Unternehmer Gustav Lippschütz (1841-1914), zuvor Direktor der Bayerischen Aktien-Bierbrauerei in Aschaffenburg, die Gärtnerbrauerei im Glockenbachviertel. Doch bereits ein Jahr später musste er in Konkurs gehen und floh nach Amerika. Die Brauerei kaufte 1892 ein Moses Erlanger aus Nürnberg.
Der gelernte Hopfenhändler und Bankier Joseph Schülein (1854–1938) erwarb 1885 den bankrotten Schwaigbräu in Haidhausen (Innere Wiener Straße, heute Einsteinstraße 42). Aus der Konkursmasse gründete er zusammen mit seinen Brüdern und Schwager Josef Aischberg im Jahr 1895 die "Unionsbrauerei Schülein und Compagnie". 1903 folgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Zum Jahreswechsel 1905 fusionierte die Unionsbrauerei mit der Münchner Kindl Brauerei und konnte so ihren Ausschank deutlich erweitern. Schüleins Bier wurde daraufhin als "Dividendenwasser" geschmäht, in der Fachzeitschrift Münchner Bier-Chronik warf man ihm die Verdrängung der Konkurrenz vor und startete eine antisemitische Hetzkampagne – der er jedoch mit einer Zivilklage beherzt den Riegel vorschob.
Viele der großen Fachgeschäfte und die ersten Kaufhäuser wurden von jüdischen Geschäftsleuten gegründet oder betrieben. 1878 gründete Heinrich Uhlfelder das Kaufhaus Uhlfelder mit Textilien, Haushaltswaren, Spielsachen und Lebensmitteln. Niedrige Preise sprachen die breite Bevölkerung an. Uhlfelder erwirtschaftete seine Gewinnspanne im Einkauf, weil er hohe Stückzahlen mit Rabbat bestellte. Auf der anderen Seite der Preisskala verkaufte Hoflieferant Lehmann Bernheimer ab 1889 in seinem luxuriösen Kaufhaus L. Bernheimer orientalische Teppiche, Kunstwerke und hochwertige Möbel.
Im selben Jahr eröffnete Oscar Tietz eine Filialle seiner Kaufhauskette "Hermann Tietz" im Pini- bzw. Imperial-Haus am Karlsplatz (Stachus). Mit aufwendigen Dekorationen, Schaufenstern und Katalogen setzte er für den Einzelhandel neue Maßstabe. Bis 1905 wurde am Bahnhofsplatz ein Neubau angesetzt, der als "Empfangssaal der Stadt" galt.
Der geadelte Jurist Sigmund von Henle (1820–1906) saß von 1871 bis 1881 als Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Max Littmann (1862–1931) errichtete das Hofbräuhaus und andere "Bierpaläste", das bereits erwähnte Kaufhaus H. Tietz am Bahnhofsplatz, das Prinzregententheater in Bogenhausen sowie Teile des Klinikums am Sendlinger Tor. Die Karikaturen von Th. Th. Heine (1867–1948) prägten den Stil der satirischen Wochenzeitschrift "Simplicissimus" bis 1933. Der literarische Verein "Phöbus", den jüdische Studenten gegründet hatten, die Salons von Carry Brachvogel (1864–1942) und Max Bernstein (1854–1925) waren feste Größen im Kulturbetrieb.
Die im neuromanischen Stil von Albert Schmidt entworfene neue Hauptsynagoge beanspruchte in der Münchner Stadtlandschaft einen prominenten Platz, wurde als Sehenswürdigkeit beworben und zeugte vom gewachsenen Selbstbewusstsein der jüdischen Bevölkerung. Diese war mehrheitlich assimilliert und im Sinne des Zeitgeistes auch patriotisch eingestellt. Als Theodor Herzl den ersten Zionistischen Weltkongress 1897 in der bayerischen Hauptstadt abhalten wollte, stieß er deshalb auf erbitterten Widerstand: Vertreter der Kultusgemeinde und des "Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" betonten, dass der Zionismus dem "Geist des Judentums" widerspräche, und sie äußerten ihr Bedauern, sollte der Kongress wirklich in Münchnen stattfinden. Herzl entschied sich letzendlich für Basel als Tagungsort.
In den 1860er und frühen 1870er Jahren hatten deutsche Studentenverbindungen relativ problemlos jüdische Mitglieder akzeptiert, weil sich Studierende ohnehin noch als gesonderte, elitäre Klasse betrachteten ("Corpsgeist"). Schmähungen gegenüber eines ihrer Mitglieder galt als ehrverletzender Angriff auf die gesamte Verbindung. Studenten jüdischen Glaubens verhielten sich konform dem waffenstudentischen Regelwerk, indem sie für antisemitische Beleidigungen Satisfaktion mit der Klinge forderten. Mit der lang anhaltenden Wirtschaftskrise nach dem Gründerkrach 1873 veränderte sich jedoch die Situation: Einerseits wurden die Chancen der Hochschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt deutlich schlechter, andererseits stieg der Anteil jüdischer Studenten immer weiter an. Zunehmend wurden Juden in der akademischen Welt als Bedrohung und Konkurrenz empfunden.
Aufgrund der wachsenden Anfeindungen entstanden seit den 1880er Jahren eigene jüdische Verbindungen. Mehrheitlich behielten sie die Organisationsformen und Wertvorstellungen des "schlagenden" Verbindungswesens bei. Später wurden auch freie Verbände und Kartellorganisationen gegründet, die ihre religiöse, zionistische oder paritätische, das heißt säkulare und politisch neutrale Einstellung betonten. Sie verzichteten daher weitgehend auf das Tragen von Verbindungsfarben (Couleur), verpflichtende Fechtübungen (Pauken), Ehrenduelle mit anderen Verbindungen (Mensur) und gemeinsame Trinkabende (Kneipe).
Den verschiedenen Verbindungen gelang es zwar nie, eine Mehrheit der jüdischen Studenten zu organisieren, dafür wurden jüdische Führungseliten der Weimarer Zeit überwiegend in ihnen sozialisiert. Das Streben nach Anerkennung blieb letztlich erfolglos, trotz der Loyalität zur deutschen Kultur und Gesellschaft, trotz des hohen Blutzolls, den ihre Mitglieder überproportional im Ersten Weltkrieg als Soldaten gezahlt hatten. Nach ihrer Machtübernahme lösten die Nationalsozialisten alle deutsch-jüdischen Verbindungen zwangsweise auf.
Unter ganz anderen Gesichtspunkten entstanden nach dem Sturz der NS-Diktatur neue Korporationen. Zeitzeuge Dr. Simon Snopkowski berichtet über die Gründung eines jüdischen Studentenbunds an der Universität München um 1946. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) vertritt seit 2016 die Interessen Studierender jüdischen Glaubens in der Bundesrepublik. Der Verband Jüdischer Studenten in Bayern (VJSB) ist die größte regionale Vereinigung für jüdischer Studierende und junge Erwachsene im Freistaat Bayern.
Burschenbund im B.C. Thuringia, 1892-1933
Die am 25. Februar 1892 ins Leben gerufene paritätische Verbindung "Thuringia München" gehörte 1919 zu den zehn Gründungsmitgliedern des reichsweiten "Burschenbunds-Convents", der freiheitlich-liberale Prinzipien vertrat. Obwohl ihre Mitglieder überwiegend jüdischer Abstammung waren, lehnten sie es entschieden ab, sich als "jüdische Verbindung" bezeichnen zu lassen. Ihre Mitglieder repräsentierten ein assimiliertes Judentum, das sich in Sachen Patriotismus nicht übertrumpfen lassen wollte, gleichzeitig aber durch die Mitgliedschaft im Deutschen Studentenbund seine Unterstützung für die Demokratie demonstrierte. Der Burschenbund Thuringia war sowohl farbentragend (Violett-Orange-Silber) als auch pflichtschlagend und führte daher die typischen Korbschläger für das akademische Fechten im Wappen. Das Verbindungshaus (sog. Thüringerhaus) lag in der Kaulbachstraße 18, parallel zur Ludwigstraße hinter der Universitätskirche St. Ludwig. Heute gehört das Anwesen der Burschenschaft Franco-Bavaria.
Verbindung im K.C. Licaria, 1895-1933
Die Verbindung Licaria wurde am 7. November 1895 gegründet. Mehrheitlich studierten die Mitglieder Humanmedizin und Rechtswissenschaften, worauf auch das Verbindungsmotto "Recht vor Macht!" hinwies. Ihre Farben waren Grün-Silber-Schwarz, die Mützen grün. Bereits im folgenden Jahr schloss sie sich mit den jüdischen Korporationen "Viadrina Breslau", "Badenia Heidelberg" und "Sprevia Berlin" zum "Kartell-Convent der Tendenz-Verbindungen deutscher Studenten jüdischen Glaubens" (KC) zusammen. Zunächst versammelten sich die Mitglieder von Licaria im Rückgebäude einer Gaststätte im Lehel (Kochstraße 5a). Die Adresse wechselte noch mehrmals. Zuletzt zog der KC Licaria in die Herzog-Rudolf-Straße 1, direkt neben die Israelitische Volksschule (Nr. 3) und die orthodoxe Synagoge (Nr. 5). Dieses Anwesen war auch die Postanschrift des VJSt Jordania. Der "Altherrenverband" (Alumni, die weiterhin der Verbindung angehören) wurde von Dr. Herbert Stein am Sendlinger Tor-Platz 6a geleitet. Licaria entwickelte sich zur zahlenmäßig größten jüdischen Verbindung. Sie war schlagend, die Mensur blieb jedoch freigestellt. Auch nichtjüdische Verbindungen akzeptierten KC Licaria als Mensur- und Satisfaktionsfähig, die gegenseitigen Beziehungen im studentischen Milieu waren nach eigenem Empfinden sehr gut.
Nach dem Sturz der Monarchie 1918 trat die jüdische Verbindung KC Licaria wegen ihrer "deutsch-vaterländischen Verpflichtung" dem Freikorps Epp bei und beteiligte sich im Frühjahr 1919 an der Niederschlagung der sozialistischen Münchner Räterepublik. Ein geschäftsführender Ausschuss unter Dr. Hermann Berlak gab noch das KC-Adressbuch 1937 heraus. Im Geleitwort heißt es: "Benutzt das Adressbuch, wo immer Euer Weg euch hin führt, um alte Freunde aufzufinden. Helft aber auch uns, durch Meldungen aller Änderungen, stets über das Schicksal jedes einzelnen unterrichtet zu bleiben". Die Fahne von KC Licaria München wird heute im Center for Jewish History in New York aufbewahrt.
VJSt Jordania 1900-1933
Der zionistisch ausgerichtete "Verein Jüdischer Studenten Jordania" gründete sich am 9. Mai 1900 als eine Korporation des zionistischen "Kartells Jüdischer Verbindungen" (KJV), welches 1914 aus dem Zusammenschluss zweier Vorgängerorganisationen entstand. Das Symbol des KJV war eine stilisierte blaue Flamme im silbernen Kreis und wurde als Anstecknadel getragen. Erst nach Kriegsende 1919 konnte der erste Kartelltag des KJV zusammentreten. Er verbot die vorher noch unbedingt (!) geforderte und gegebene Satisfaktion. Außerdem wurde das zuvor strenge Maturitätsprinzip gelockert und die Statuten auf das zionistische Baseler Programm ausgerichtet: Ziel war die Ausbildung verantwortungsvoller Zionisten, die sich für eine Erneuerung des jüdischen Volkes und den Aufbau einer Heimstatt in Palästina (Erez Israel) einsetzen sollten. Unter anderem erlernten Mitglieder die hebräische Sprache. Im Jahr 1931 bestand das KJV aus 19 Verbindungen mit insgesamt 600 Aktiven und Inaktiven sowie 1400 Alten Herren. Der VJSt Jordania führte die Couleur Blau-Silber-Gold (Silber bzw. Weiß und Blau sind die Farben des Zionismus). Da es sich um keine Studentenverbindung im klassischen Sinne handelte, wurden diese Farben jedoch nur in Bier- und Weinzipfeln verwendet, die man traditionell untereinander tauschte oder an Mitglieder befreundeter Korporationen verschenkte. Aufgrund seiner religiös-politischen Ausrichtung blieb VJSt Jordania außerdem nichtschlagend. Die Postanschrift des Vereins war das jüdische Studentenhaus in der Herzog-Rudolf-Straße 1.
Vereinigung jüdischer Akademiker 1904-1933
Auch die im Mai 1904 gegründete VJA war keine studentische Verbindung im klassischen Sinne, sondern ein Ortsverband des im Jahr zuvor entstandenen, konfessionellen "Bunds Jüdischer Akademiker" (BJA). Als religiös-orthodoxer Studentenverein führte die VJA keine Farben. Ihre Mitglieder tauschten und verschenkten lediglich einen Bier- bzw. Weinzipfel aus schwarzem Tuch mit silberner Perkussion. Auf gesamtdeutschen Bundestagen wurden organisatorische, aber auch wissenschaftliche und religiöse Fragen behandelt. Der BJA hatte bei seiner zwangsweisen Auflösung 1933 rund 800 Mitglieder in insgesamt zehn Mitgliedsbünden. Die Mitglieder der Vereinigung bezogen öffentlich keine gesellschaftspolitischen Positionen, typische Merkmale einer Studentenverbindung hatte der BJA ebenfalls kaum. Er unterschied nicht zwischen Aktiven und Alten Herren und lehnte Mensur, Couleur und Kneipe ab. Ihm ging es um Glauben, Kultur und Wissenschaft. Der sog. "Fuxenunterricht" der jüngeren Semester diente vor allem dazu, über die jüdische Weltanschauung und ein Leben gemäß der Kaschrut zu informieren. Fast allwöchentlich gab es entsprechende Vortragsabende. Die Vereinigung traf sich in der Wohnung von Ulrich Ascher (Prinzregenstraße 18), die auch als Postablage für eine "Jüdische Studentinnengruppe" diente.
Burschenbund im B.C. Südmark-Monachia München 1923-1933
Angesichts der wachsenden antisemitischen und demokratiefeindlichen Bedrohung durch völkisch-nationale Kreise rief eine Gruppe aus BC-Burschen und freiheitlich denkenden Waffenstudenten, die ihre rechtsgerichteten Korporationen verlassen hatten, am 4. Januar 1923 die "Vereinigung Südmark-Monachia" ins Leben. Unter dem Motto "Deutsch, Treu und Frei" traten sie dem 1919 gegründeten paritätischen "Burschenbunds-Convent" bei. Die Verbindung war schlagend und farbentragend, ihre Couleur Grün-Blau-Silber. Zu den bekannten Mitgliedern zählen unter anderem der Rechtswissenschaftler Robert Piloty (1863–1926), der FDP-Politiker Thomas Dehler (1897–1967) und der linksliberale Politiker Hugo Preuß (1860–1925), die alle als Alte Herren beitraten. Zuletzt hatte der Burschenbund seinen Sitz direkt gegenüber dem Münchner Hofbräuhaus in der Bräuhausstraße 4.
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wuchs die Kultusgemeinde von 8.739 auf 11.083 Mitglieder an, rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Dortmunder Brüder Moritz und Julius Wallach (1874–1965) gründeten im Jahr 1900 das "Volkstrachtenhaus Wallach" (Lindwurmstraße 11, später Residenzstraße 3). Sie belieferten das Jubiläums-Oktoberfest 1910 und statteten das Ensemble des international erfolgreichen Lustspiels Das Weiße Rössl aus. Die Brüder Wallach gelten daher als Erfinder der modernen Trachtenmode. Bekannt war auch der "Joppenkönig" Isidor Bach (1849–1946), dessen "Spezialhaus für Herren-, Jünglings-, Knabengarderobe, Jagd, Sport & Livréen" (Sendlingerstraße 3) später unter dem Namen seines nichtjüdischen Mitarbeiters Johann Konen weitergeführt wurde. Im Kriegsjahr 1914 eröffnete das Familienunternehmen Bamberger & Hertz ein großes Bekleidungsgeschäft in der Kaufingerstraße 28, heute Hirmer. Franz Kafka (1883–1924) gab am 10. November 1916 in der Galerie Goltz (Brienner Straße 8) eine Lesung aus dem Werk "In der Strafkolonie": Es war einer von nur zwei öffentlichen Auftritten seines Lebens, und Kafka freute sich wohl in erster Linie darauf, seine damalige Verlobte Felice Bauer aus Berlin zu treffen. Beide wohnten im Hotel "Bayerischer Hof" (Promenadenplatz 2-6), allerdings in getrennten Zimmern. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges spendete der deutsch-amerikanische Kunstsammler und Philantrop James Loeb (1867–1932) große Summen für die Versorgung der notleidenden Münchner Bevölkerung. Er finanzierte außerdem das erste Wohnheim für Studentinnen ("Marie-Antonie-Haus") und in Murnau ein Gemeindekrankenhaus mit 60 Betten.
Zahlreiche prominente Revolutionäre, die sich nach der deutschen Niederlage im Weltkrieg am Sturz der Monarchie beteiligen, waren jüdischer Herkunft (u.a. Gustav Landauer, Erich Mühsam, Sarah Lerch und Eugen Leviné). Der Hass der Republikgegner entlud sich auch gegen den jüdischen USPD-Politiker Kurt Eisner (1867–1919), der am 8. November 1918 den Freistaat ausgerufen hatte: Bayerns erster Ministerpräsident fiel einem Attentat des rechtsradikalen Anton Graf von Arco auf Valley zum Opfer. Die konservativ eingestellte Mehrheit der Münchner Juden lehnte die sozialistische Räterepublik ab und unterstütze deren Niederschlagung, unter anderem Studenten der Verbindung K.C. Licaria. Der prominente jüdische Rechtsanwalt Philipp Löwenfeld betonte in einer Rede, dass die Vertreter des Rätesystems "zu neunzig Prozent landfremde bolschewistische Agenten" seien. Trotzdem verfestigte sich in der Mehrheitsgesellschaft eine feindselige Grundstimmung, in der Juden – vor allem osteuropäischer bzw. russischer Herkunft – mit sozialistischen "Vaterlandsverrätern" gleichgesetzt wurden. Am 23. April 1920 ordnete Ministerpräsident Gustav von Kahr die Ausweisung von rund 300 ostjüdischen Familien aus München an. Dies konnten jedoch Proteste der jüdischen Gemeinde und der Presse noch einmal verhindern. München entwickelte sich von einer liberalen Stadt zur "Ordnungszelle" des Reiches und einem Zentrum des Antisemitismus. Die wichtigste Rolle spielte dabei die am 20. Februar 1920 im Münchner Hofbräuhaus gegründete, ab 1921 von Adolf Hitler geführte Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).
Im Jahr 1921 fusionierte Hermann Schülein (1884–1970) das Brauimperium seines Vaters mit der angeschlagenen Münchner Löwenbräu AG. Dadurch wurde Löwenbräu auf kommende Jahrzehnte die größte deutsche Export-Biermarke mit einem Ausstoß von rund einer Millionen Hektolitern.
Im Krisenjahr 1923 wurde die deutsche Gesellschaft durch Hyper-Inflation, Ruhrbesetzung und politische Gewalt erschüttert. In München warf der Hitlerputsch seine Schatten voraus: Jüdische Personen des öffentlichen Lebens wurden auf offener Straße angegriffen und zum Teil erheblich verletzt. Am 5. Januar störten nationalsozialistische Krawallmacher im Residenztheater die Uraufführung von Lion Feuchtwangers (1884–1958) Stück "Der holländische Kaufmann". Auch bei der Premiere von "Nathan der Weise" in den Regina-Festspielen kam es am 9. Februar zu antisemitischen Protesten, daher wurde der Film nicht mehr gezeigt. Ein US-amerikanischer Tourist wurde von SA-Männern abgepasst und musste seine Hosen öffnen, um zu beweisen, dass er nicht beschnitten war. Der Vorfall erregte in der amerikanischen Presse großes Aufsehen und hatte Reisewarnungen für München zur Folge. Gustav von Kahr, inzwischen zum Generalstaatskommissar ernannt, ordnete am 23. Oktober erneut die Ausweisung von rund 180 jüdischen Familien aus Osteuropa an ("Verschärfter Zugriff").
Am Abend auf den 9. November 1923 begann der sogenannte Hitlerputsch, der auch als Hitler-Ludendorff-Putsch oder Bierhallenputsch bezeichnet wird, im Münchner Bürgerbräukeller (Rosenheimer Straße). Der schlecht geplante Staatsstreich scheiterte vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz. Die NSDAP wurde daraufhin vorübergehend verboten, Hitler zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Doch bereits neun Monate später kam er wieder frei. München blieb eine Hochburg antisemitischer sowie rechtsradikal-völkischer Kreise. Viele sozialkritische Kunstschaffende und Intellektuelle verließen demonstrativ die Stadt. In Landsberg am Lech und München entstand Adolf Hitlers "Mein Kampf". Im ersten Band mit dem Untertitel "Eine Abrechnung" (1925) beschreibt Hitler seine ideologische Weltanschauung und den Aufbau der NSDAP, im zweiten wiederholt und ergänzt er seine programmatischen Aussagen ("Die nationalsozialistische Bewegung", 1926).
Ende der 1920er Jahre nahm das Kaufhaus Uhlfelder einen Großteil des Gebäudeblocks zwischen Nieserstraße und Pettenbeckstraße ein. Zum 50-jährigen Bestehen der Firma 1928 waren auf 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche 550 Angestellte in dem Kaufhaus tätig, das über einen Streichelzoo und hauseigene Gastronomie und seit 1931 auch über eine Rolltreppe verfügte, die die drei Stockwerke des Unternehmens erschloss. Die großen Münchner Warenhäuser blieben Antisemiten ein Dorn im Auge, weil die "jüdische Kaufhauskultur" angeblich den deutschen Einzelhandel zerstörte.
Im Sommer 1930 organisierten und kuratierten Kunsthistoriker Theodor Harburger (1887–1949) und der Privatsammler Dr. Heinrich Feuchtwanger (1889–1963) die "Ausstellung jüdischer Kultgeräte und -einrichtungen für Synagoge und Haus", die vom VBG und der IKG München getragen wurde. Unter dem Einfluss dieser Ausstellung gründete sich der "Verein für jüdische Museen in Bayern", der sich das Ziel setzte, Ritualien und Kunstgegenstände vom historischen oder künstlerischen Wert, Fotografien, Archivbestände usw. zu sammeln und zu bewahren. Den Vorsitz übernahm der Münchner Rabbiner Dr. Leo Baerwald (1883–1970), Theodor Harburger wurde sein Geschäftsführer.
Nach der NS-Machtübernahme in Berlin wurde der NSDAP-Politiker Franz Xaver von Epp (1868–1947) am 9. März 1933 als Reichskommissar in Bayern eingesetzt. Sozialdemokraten und Gewerkschafter, ehemalige Minister, aber auch 280 Juden kamen in Haft. Letztere wurden teilweise im neu errichteten Konzentrationslager Dachau interniert. Am nächsten Tag kam es zu einem Vorfall, der weltweit großes Aufsehen erregte: Nachdem Rechtsanwalt Dr. Michael Siegel (1882–1979) auf der Hauptpolizeiwache den Vandalismus am Kaufhaus seines Mandanten Max Uhlfelder angezeigt hatte, wurde er dort so stark verprügelt, dass ihm ein Trommelfell platzte und Zähne ausfielen. Anschließend trieb ihn ein SA-Trupp barfüßig und mit abgeschnittenen Hosenbeinen von der Ettstraße über den Stachus zum Hauptbahnhof.
Ein zufällig anwesender Fotograf machte von dieser öffentlichen Demütigung zwei Aufnahmen, die am 23. März in der "Washington Times" veröffentlicht wurden. Zwischen 1933 und 1942 zogen rund 7500 Jüdinnen und Juden aus München weg; sie emigrierten vor allem nach Westeuropa, in Palästina und die USA. Zu ihnen gehörten auch die Rabbiner Dr. Robert Raphael Geis, Dr. Ernst Ehrentreu, Simon Wiesner und Dr. Leo Baerwald. Seit 1935 trug München den NS-Ehrentitel "Hauptstadt der Bewegung". Am 8. November 1937 eröffnete Propagandaminister Joseph Goebbels (1897–1945) im Deutschen Museum die Schau Der Ewige Jude. Sie wurde als Wanderausstellung konzipiert und anschließend in Wien, Berlin, Bremen, Dresden sowie Magdeburg gezeigt. Allein in München verzeichnete das diffamierende Machwerk 412.300 Besucher.Mit einem "Führerbefehl" ordnete Adolf Hitler die Zerstörung der Hauptsynagoge an. Bereits am 9. Juni 1938 wurde – offiziell aus verkehrstechnischen Gründen – mit dem Abriss begonnen. In den staatlich gelenkten Novemberpogromen zur Nacht auf den 10. November 1938 brannten die übrigen Münchner Synagogen. Trupps der SA, aber auch Sympathisanten aus der Zivilbevölkerung plünderten und zerstörten jüdische Geschäfte. Zwischen September 1933 und Sommer 1942 schieden offiziell 176 jüdische Münchner freiwillig aus dem Leben. Die zum Christentum konvertierte Schriftstellerin Elisabeth Braun (1884–1941) bot bis zu 15 befreundeten Jüdinnen und Juden im "Hildebrandhaus" (Maria-Theresia-Straße 22) ein Obdach, bis auch sie selbst entmietet und letztendlich deportiert wurde. Ende 1939 waren von den 2252 jüdischen Unternehmen (Stand 1933) bis auf 27 alle durch den staatlichen Druck "arisiert".
Das Auswanderungsverbot vom 23. Oktober 1941 versperrte die letzten Fluchtwege. Rund 3000 Jüdinnen und Juden aus München wurden ab November in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Im Stadtteil Milbertshofen bauten jüdische Zwangsarbeiter bis zum 13. März 1941 ein abgeriegeltes Sammellager, die sog. "Judensiedlung Milbertshofen" (Ecke Troppauer Straße / Knorrstraße). Ein weiteres Lager entstand in einem Teil des Klosters der Barmherzigen Schwestern in Berg am Laim (Sankt Michael-Straße 16). Weil vor allem Senioren und Kranke darin unterkamen, nannten es die Nationalsozialisten zynisch eine "Heimanlage für Juden". Durch die Zwangsumsiedlung wurden rund 1500 Wohnungen neu vergeben, vorrangig an "verdiente Parteigenossen". Die Bewohner der Sammellager mussten in verschiedenen Betrieben Zwangsarbeit leisten und verwalteten sich intern selbstständig; dem letzten Leiter Curt Mezger (1895–1945) wurde im Jahr 2007 der Curt-Mezger-Platz in Milbertshofen gewidmet.
Insgesamt kamen 4476 Menschen, die in München geboren wurden oder dort während der NS-Zeit lebten, in der Shoah zu Tode. Als die 7. US-Armee am 30. April 1945 in das kriegszerstörte München einrückte, lebten nur noch sieben Jüdinnen und Juden in der Stadt.
Die jüdische DP-Gemeinde München entstand bereits in der zweiten Jahreshälfte 1945. Im Stadtteil Bogenhausen wurde ein Teil des Villenbestands von der amerikanischen Besatzungsmacht für diverse Hilfsorganisationen beschlagnahmt. Die Villa Lauer (Neuberghauserstraße 11) wurde zur Synagoge mit Unterkünften, einem Schlachtraum und Mikwe umgebaut. In der ehemaligen Landesversichungsanstalt von Oberbayern (Holbeinstraße 9/11) befanden sich die Räumlichkeiten der "Behörde für das Flüchtlingswesen" und des "Staatskommissars für rassisch, religiös und politisch Verfolgte" Philipp Auerbach (1906–1952). Nahebei entstand ein UNRRA-Krankenhaus (Mühlbaurstraße 15), das ab April 1949 bis zu seiner Schließung im Mai 1951 als rein jüdische Einrichtung mit einer koscheren Küche geführt wurde. Die größtenteils selbst verwaltete DP-Gemeinde unter dem Vorstand Chaim Hirsch Schwimmer (Möhlstraße 43) betrieb ein hebräisches Gymnasium sowie zwei Sportvereine.
Die in München lebenden Jüdinnen und Juden gehörten im Wesentlichen zwei unterschiedlichen Gruppen an: Ein kleiner Teil hatte die NS-Zeit in München überlebt oder war aus den befreiten Lagern der Umgebung zurückgekehrt. Die Mehrheit bestand aus osteuropäischen Displaced Persons (DPs), die in Deutschland eine Heimat auf Zeit fanden. Hier sollten sie wieder zu Kräften kommen und sich in Ruhe auf ein neues Leben in Israel – dessen Gründung im Mai 1948 sich trotz vieler Probleme bereits abzeichnete – oder in anderen Ländern vorbereiten. Aus dem Zusammenschluss von überlebenden deutschen Juden und im Lande bleibenden DPs gingen viele der modernen, heute bestehenden Kultusgemeinden hervor. Trotzdem kam es zu Interessenskonflikten zwischen den kulturell, sprachlich und biographisch unterschiedlichen Gruppen. Im Frühsommer 1945 forderte das "Zentralkomitee der befreiten Juden in der amerikanischen Zone", welches die Interessen der DPs vertrat, die Hilfsorganisation "American Jewish Joint Distribution Committee" (AJDC bzw. Joint) dazu auf, an deutsche Juden keine Hilfsgüter mehr auszugeben.
Weil Bayern vollständig zum US-Amerikanischen Besatzungsgebiet gehörte, kam München eine besondere logistische Bedeutung zu. Die Militärverwaltung richtete zusammen mit der "United Nations Relief and Rehabilitation Administration" (UNRRA) im Stadtgebiet und dem Umland ein Reihe von Durchgangs- oder Sammellagern (engl. Camps) für DPs ein. Das große Areal des Deutschen Museums auf der Kohleninsel wurde von 1945 bis 1947 zu einem ersten Durchgangslager für alle politisch oder rassisch verfolgten DPs. Die UNRRA druckte für sie den D.P. Express, eine Wochenzeitung in jiddischer, russischer, polnischer, französischer sowie deutscher Sprache. Eine "Internationale UNRRA Universität" bot ab Februar 1946 die Möglichkeit, einen akademischen Abschluss nachzuholen. Zu Beginn des Jahres 1946 wurde in der Schwabinger Funkkaserne ein weiteres Transitlager eingerichtet. Mit bis zu 1.600 Bewohnern erreichte es bald seine Kapazitätsgrenze, daher zogen im Frühjahr 1948 alle jüdischen Bewohner in die Kaserne München-Freimann um (heute Ernst-von-Bergmann-Kaserne).
Mit Unterstützung der Militärregierung organisierte Jella Lepman (1891–1970) von München aus eine "Internationale Jugendbuchausstellung" (1946), die später den Grundstock der Internationalen Jugendbibliothek bildete. Der Profisportler und Journalist Alexander Hochhäuser (1912–2004) dokumentierte den Alltag im kriegszerstörten München. Die jüdische DP-Gemeinde wuchs bis Mai 1947 auf 9390 Personen an und hielt sich bis zur Gründung des Staates Israel 1948 auf hohem Niveau. Wer dauerhaft bleiben wollte, schloss sich 1951 der neu gegründeten Israelitischen Kultusgemeinde München/Oberbayern an.
Im Münchner Außenbereich entstanden zwei weitere Einrichtungen für jüdische DPs: Eine kleinere Gemeinde in dörflich geprägten, erst 1938 eingemeindeten Stadtteil Feldmoching und in Freimann ein Lager namens "Neufreimann". Letzteres wurde Januar 1946 in der Arbeitersiedlung Kaltherberge eingerichtet und nahm anfangs 1487 Menschen auf. Die Höchstzahl wurde im Juli 1947 mit 2095 DPs erreicht. Der gewählte Lagervorstand (Zwi Burko und Josef Kornblitt) organisierte den Sportclub "Makabi München-Freimann" sowie eine Bibliothek, einen Kindergarten, und zur Vorbereitung auf die Auswanderung eine Volksschule für Kinder sowie eine Berufsschule. Für das religiöse Leben standen eine Synagoge und eine Religionsschule (Cheder) bereit. Ein Ritualbad ist in den Quellen zwar nicht erfasst, bestand aber aller Wahrscheinlichkeit nach. Nach der Gründung des Staates Israel 1948 schrumpfte auch dieses DP-Lager und wurde im Mai 1950 aufgelöst. Die DP-Gemeinde in Feldmoching war im Verhältnis zu ihrer Größe ungewöhnlich religiös, wahrscheinlich wurden hier gezielt streng konservative bzw. orthodoxe Jüdinnen und Juden untergebracht. Es gab eine koschere Küche, die rund 300 privat untergebrachte jüdische DPs versorgte, eine Betstube und eine Jeschiwa, wo Rabbiner Murr mit zwei weiteren lehren fünfzehn Studenten in der Tora und dem Talmud unterrichtete. Auch diese DP-Gemeinde ging 1951 in der IKG München/Oberbayern auf. Viele weitere jüdische DPs fanden in der Umgebung Münchens eine Unterkunft, in Fürstenfeldbruck, Feldafing, Föhrendwald (Waldram), Sankt Ottilien und Landsberg am Lech.
Am 19. Juli 1945 wurde im ehemaligen Jüdischen Altenheim in der Kaulbachstraße die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern gegründet. Die anwesenden 105 Jüdinnen und Juden wählten den Kinderarzt Dr. Julius Spanier zum Präsidenten. Seine Nachfolge trat später Rechtsanwalt Fritz Neuland (1889–1869) an, Vater der heutigen Gemeindepräsidentin Charlotte Knobloch (*1932). Im März 1946 gehörten der Kultusgemeinde bereits rund 2800 Jüdinnen und Juden an, von denen 796 bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in München gelebt hatten. Laut einer Schätzung des Joint Distribution Committee (JDC) gab es im April rund 7000 Juden im Raum München, die meisten von ihnen waren als DPs in der einstigen "Hauptstadt der bewegung" gestrandet.
Von 1970 bis zu seinem Tod amtierte Dr. Hans Lamm (1913–1985) als Vorsitzender der IKG München/Oberbayern. Sein besonderes Augenmerk galt einer Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Münchens und der langfristigen Versöhnung. Ende der 1970er Jahre kamen zahlreiche Jüdinnen und Juden aus der damaligen Tschechoslowakei und aus Polen nach München, so dass die IKG München und Oberbayern Ende der 1980er Jahre rund 4500 Mitglieder zählte. Da sich seit Beginn der 1990er Jahre zahlreiche "Kontingentflüchtlinge" (Juden aus der ehemaligen Sowjetunion) in der Landeshauptstadt niederließen, verdoppelte sich die Mitgliederzahl der IKG München auf rund 9500 Personen. Sie wurde dadurch die zahlenmäßig größte Kultusgemeinde in Deutschland, gefolgt von Berlin und Düsseldorf (Stand 2023). Zu den Einrichtungen der IKG gehören unter anderem ein Jugend- und Kulturzentrum, eine Bibliothek, die Jüdische Volkshochschule München, das 1982 wiedereröffnete Saul-Eisenberg-Seniorenheim in Schwabing, die Sinai-Grundschule mit einem Hort, ein Kindergarten und eine Integrationsstelle für Zuwanderer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion.Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand in München die Liberale jüdische Gemeinde "Beth Shalom", die aus einem anfänglich informellen Zusammenschluss hervorging. Die Gruppe setzte sich ursprünglich hauptsächlich aus in München stationierten Soldaten der US-Armee sowie Mitarbeitern von "Radio Free Europe" (u.a. Pavel Kohn) zusammen, die sich für eine liberale, das heißt nach eigener Aussage "zeitgemäße Interpretation und Ausübung des Judentums" entschieden hatten. Da sich die Gruppe unter anderem wegen abweichender Ansichten über die Stellung der Frau nicht der 1951 neu gegründeten, eher konservativ orientierten IKG München/Oberbayern anschließen wollte, entschied sie sich im Jahr 1995 für die Gründung des Vereins "Beth Shalom". Aus ihm ging die Liberale Jüdische Gemeinde München hervor. Seit 2003 mietet sie Räume in Mittersendling für einen Betsaal und ein Gemeindezentrum. Heute steht die Gemeinde nach eigener Aussage für die "Kritische Reflexion von Tradition und Moderne, angepasste Formen von Gottesdienst, Feiertagen und Alltagsleben".
Am 13. Februar 1970 erschütterte ein bis heute nicht aufgeklärter Brandanschlag auf das Altenheim der Kultusgemeinde die Öffentlichkeit. Sieben jüdische Heimbewohner kamen ums Leben. Weltweites Aufsehen erregte während der in München ausgetragenen zwanzigsten Olympischen Sommerspiele 1972 das am 5. September von der palästinensischen Terroristenorganisation "Schwarzer September" durchgeführte Attentat auf die israelische Olympiamannschaft, dem elf israelische Sportler zum Opfer fielen. Kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats einigten sich am 31. August 2022 die Stadt München, der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland und die Hinterbliebenen der Opfer auf die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 28 Millionen Euro.
Zur Jahrtausendwende sollte endlich wieder ein angemessenes jüdisches Gemeindezentrum entstehen. Als Bauplatz wurde nicht zuletzt wegen seines Namens der zentral gelegene St.-Jakobs-Platz gewählt. Im Jahr 2000 setzte sich ein Entwurf durch, der sich durch eine postmoderne Architektur bewusst von der historischen Umgebung abheben wollte. Drei Jahre später wurde ein geplanter Anschlag der "Kameradschaft Süd" auf die Grundsteinlegung von der Polizei vereitelt.
Das dreigliedrige Ensemble besteht aus einem Gotteshaus, einem Gemeindezentrum mit Ritualbad, Restaurant und Veranstaltungsfläche, sowie dem Jüdischen Museum. Es wurde am 9. November Jahr 2006 feierlich eingeweiht. Die neue Synagoge trägt in Anlehnung an die 1938 zerstörte orthodoxe Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße den Namen "Ohel Jakob" (hebr. Zelt Jakobs). Seit 2009 gibt es in München ein Bildungszentrum der Europäischen Janusz Korczak Akademie, einer Tochterorganisation der Jewish Agency for Israel. Ihr Ziel ist eine interkulturelle, interreligiöse Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Neben München hat die Akademie noch zwei weitere Standorte in Berlin und Duisburg. Kaum jemand ist nach Zweitem Weltkrieg und Holocaust davon ausgegangen, dass in Deutschland je wieder ein blühendes jüdisches Leben möglich sein würde – eine lebendige jüdische Gemeinschaft in Bayern beweist heute das Gegenteil.Dabei kämpft sie mit verschiedenen Herausforderungen: Die Mitgliedszahlen der Gemeinden sind seit 2006 wieder rückläufig, die Sterberate ist hoch, die Geburtenrate niedrig. Doch nicht nur die Demographie macht dem bayerischen Judentum zu schaffen, fraglos ist der Antisemitismus auch weiterhin präsent, was nicht zuletzt die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD auch in Bayern zeigen. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat sich die Conference of European Rabbis (Europäische Rabbinerkonferenz, CER) auf die Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten hin dennoch dafür entschieden, ihren Sitz 2023 von London nach München zu verlegen. Mit einem vom Freistaat Bayern geförderten "Zentrum für jüdisches Leben", in dem Rabbiner und Rebbetzins ausgebildet werden sollen, will die Organisation ihre Aktivitäten in München "deutlich erweitern", wie es in einer Presseerklärung heißt. Durch die internationale Arbeit des CER, die Ohel-Jakob-Synagoge und das jüdische Zentrum im Herzen der Altstadt ist München heute ein neuer Kristallisationspunkt für jüdisches Leben in Europa.
Die historisch gewachsene Bausubstanz der Innenstadt ist heute größtenteils verloren gegangen. Neben dem Alten und Neuen Israelitischen Friedhof gibt es aber trotzdem noch viele prägnante Bauwerke, die großteils unter Denkmalschutz stehen und für sich genommen Erinnerungsorte des jüdischen Lebens vor der Shoah bilden: Zum Beispiel die großen Kaufhäuser Bach, Binswanger und Tietz, die Mälzerei von Schüleins Unionsbräu in Haidhausen oder das ehemalige Verbindungshaus von B.C. Thuringia in der Maxvorstadt. An der Längsseite des Münchner Stadtmuseums hängen die Leuchtbuchstaben "Kaufhaus Uhlfelder". Einzelnen Persönlichkeiten wurden individuelle Gedenktafeln gewidmet: Ben-Chorin, Braun, Einstein, Heine, Landauer, Lepman, Loeb und Schülein. Die weit verbreiteten Stolpersteine des Künstlers Gunther Demnig (*1947) können in München aufgrund eines Stadtratsbeschlusses von 2015 nicht mehr auf öffentlichem Grund verlegt werden. Stattdessen bringt die Aktion Erinnerungszeichen seit 2018 Gedenktafeln und Stelen an. Insgesamt gibt es 147 Stolpersteine auf privatem Grund (Juli 2022), sechs sind im Kunstpavillon und im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst ausgestellt, 203 verwahrt die Stadt. Zahlreiche weitere Mahnmale gedenken den Opfern der Nationalsozialisten und der gewaltsamen Auslöschung des jüdischen Lebens:
Bereits im Jahr 1946 wurde der Platz der Opfer des Nationalsozialismus als begehbares Mahnmal angelegt. Die Grünfläche bildet eine Verbindung zur Brienner Straße 20, wo sich im 1944 zerstörten Wittelsbacher Palais das bayerische Hauptquartier der Gestapo befand. 1965 wurde ein von Karl Oppenrieder gestalteter zweieinhalb Meter hoher Stein aus Flossenbürger Granit mit der Inschrift "Den Opfern des Nationalsozialismus" aufgestellt. Nachdem in den achtziger Jahren vermehrt Einwände gegen diese provisorische Lösung laut wurden, beschlossen 1983 die Fraktionen des Münchner Stadtrats, einen Wettbewerb für den Entwurf eines neuen Mahnmals ausloben zu lassen. Am 8. November 1985 wurde schließlich das zweite und heutige Denkmal eingeweiht. Das sechs Meter hohe Monument von Andreas Sobeck bringt mit seiner Ewigen Flamme hinter einem zeichenhaften Kerker sowohl den totalitären Charakter des NS-Regimes als auch die Hoffnung und Sehn sucht nach Freiheit symbolisch zum Ausdruck. Nach einem Umbau wurde der Platz am 27. Januar 2014 wieder der Öffentlichkeit übergeben.
Nach 1945 ging das Grundstück der abgerissenen Hauptsynagoge an die IKG München zurück. Sie verkaufte es an die Landeshauptstadt zur freien Verfügung, mit der Auflage, eine Teilfläche als Gedenkplatz umzugestalten. Ende 1967 ließ der Stadtrat einen Wettbewerb unter Bildhauern aus Israel und Deutschland durchführen, bei dem der Münchner Herbert Peters mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Das 1969 eingeweihte Denkmal erinnert in seiner massiven Form an einen Eckstein des abgerissenen Gotteshauses und stellt somit dessen Präsenz sinnbildhaft dar. Seine Rückseite wurde mit Nischen gestaltet, die Symbole des Judentums wie den siebenarmigen Leuchter (Menora), Zeichen des ewigen Lichts und des Fortlebens, schützend bergen. Die hebräischen Inschriften zitieren Auszüge aus dem 74. Psalm ("Gedenke dies - der Feind höhnte Dich"), der Klage vor dem entweihten Heiligtum, sowie aus den Zehn Geboten. Seit 1998 ist der Gedenkstein am 9. November, dem Jahres tag der Pogromnacht, Ort der Gedenkveranstaltung "Jeder Mensch hat einen Namen". Jugendliche, Prominente aus Kultur und Gesellschaft und Münchner Bürgerinnen und Bürger verlesen zu diesem Anlass über viele Stunden die Namen, außerdem das Alter, das Todes- oder Deportationsdatum und den Sterbeort der Frauen, Männer und Kinder, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Im Jahr 2008, anlässlich des 70. Jahrestages der Pogromnacht, fand die Lesung erstmals im gesamten Stadtgebiet verteilt statt.
Im Jahre 1958 – zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt München – wurde im ersten Stock des Neuen Rathauses am Marienplatz ein kapellenartiger Gedenkraum für kommunale Beamte und Angestellten neu gestaltet. Seitlich zu einem von Karl Knappe geschaffenen goldfarbenen Steinmosaik hängen zwei Marmortafeln: Eine erinnert an die Toten der beiden Weltkriege, die andere gedenkt den politisch Verfolgten in der NS-Herrschaft. Mit einer weiteren, an der Treppe vor dem ersten Stockwerk im November 2000 angebrachten Tafel wird "in Trauer und Scham – und entsetzt über das Schweigen der Mitwissenden" der am 20. November 1941 von München nach Kaunas (heute Kowno) in Litauen 1941 deportierten und wenig später ermordeten eintausend jüdischen Frauen und Männer gedacht.
An der Westfassade vom Alten Rathaus wurde nach der Rekonstruktion eine Gedenktafel angebracht, die an den verhängnisvollen "Kameradschaftsabend" der NSDAP am 9. November 1938 gemahnt. Propagandaminister Joseph Goebbels hielt eine Rede, in der er "dem Weltjudentum" die Verantwortung für ein Attentat auf den Pariser Botschaftssekretär Ernst Eduard von Rath zuschob. Sie gilt als Auslöser der staatlichen organisierten, deutschlandweiten sog. Novemberpogrome. Der im Tafeltext verwendete Begriff "Reichskristallnacht" gilt seit den 1980ern als problematisch und wird heute nicht mehr verwendet. Insofern ist das Denkmal für sich genommen bereits ein Zeugnis des fortlaufenden politischen und wissenschaftlichen Diskurses in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus.
Am ehemaligen Nordeingang des Sammellagers im Stadtteil Milbertshofen (sog. "Judensiedlung", Ecke Troppauer Straße / Knorrstraße), heute komplett von einem Gewerbegebiet überbaut, errichtete die Stadt 1982 ein Mahnmal des Künstlers Robert Lipp. Die Bronzeplastik erinnert an eine Menora, wie auch an einen Baum und trägt die Inschrift: "Für viele jüdische Mitbürger begann 1941/43 der Leidensweg in die Vernichtungslager mit ihrer Einweisung in das Münchner Sammellager hier an der Knorrstraße 148".
Ein weiteres Mahnmal steht seit 1987 vor dem ehemaligen Sammellager in Berg am Laim (Clemens-August-Straße). Der Bildhauer Nikolaus Gerhart schuf einen Granitblock, der das jetzt frei stehende Portal des abgerissenen Klostergebäudes blockiert. Rechts daneben befindet sich eine Gedenktafel für die Schriftstellerin Else Rosenfeld (1891-1970), von 1938 bis 1942 Sozialarbeiterin der IKG München.
Den israelischen Opfern des Olympia-Attentats von 1972 ist im Olympiapark an der Hanns-Braun-Brücke ein großes Mahnmal gewidmet, das 1995 aufgestellt wurde. Die Skulptur des deutschen Bildhauers Fritz Koenig (1924–2017) trägt den Titel "Klagebalken". In hebräischen Buchstaben sind die Namen der elf getöteten israelischen Geiseln eingemeißelt: Mosche Weinberg, Yossef Romano, Ze'ev Friedman, David Mark Berger, Yakov Springer, Eliezer Halfin, Yossef Gutfreund, Kehat Shorr, Mark Slavin, André Spitzer, Amitzur Schapira und in lateinischen Lettern Anton Fliegerbauer, ein Polizist der beim Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck ums Leben kam. Vor der Unterkunft der Sportler in der Connollystraße 31 wurde ebenfalls eine deutsch-hebräische Gedenktafel aufgestellt.
Um vor der NS-Gedenktafel an der Feldherrnhalle den obligatorischen Hitlergruß zu vermeiden, gingen viele Passanten von der Residenzstraße über die Viscardigasse in die Theatinerstraße. Die Münchner nennen daher die Viscardigasse teilweise bis heute "Drückebergergassl". Um an diesen zivilen Widerstand zu erinnern, wurde 1995 eine vom Bildhauer und Bronzegießer Bruno Wank (1961*) gestaltete Bronzespur aus Pflastersteinen in die Gasse eingelassen (Titel: Argumente). Die unbehandelten Bronzewürfel erhalten durch die Füße der Passanten eine glänzende Oberfläche, dunkeln aber bei niedriger Frequentierung wieder nach: Ein Symbol für die Fragilität unserer Demokratie.
An die studentische Widerstandsgruppe "Weiße Rose" um die Geschwister Sophie und Robert Scholl erinnert ein schwarzer Kubus im Hofgarten vor der Bayerischen Staatskanzlei, entworfen von Leo Kornbrust (1921–1929) und im Jahr 1996 enthüllt. Die Mitglieder der Weißen Rose wurden denunziert, in einem Scheinprozess verurteilt und 1943 hingerichtet.
Im 2006 eingeweihten jüdischen Zentrum am St.-Jakobs-Platz verbindet ein 32 Meter langer unterirdischer Gang die Synagoge und das Gemeindezentrum. Er wurde vom Lichtkünstler Georg Soanca-Pollack (*1967) als "Gang des Erinnerns" gestaltet und trägt die Namen aller 4500 in der Shoah ermordeten Münchner Juden auf opaken Glasplatten, die zu einer einzigen geformt wurden. So entsteht der plastisch-changierende Eindruck von herausgehobenen und zurücktretenden Namen.
Eine große Gedenktafel an der Fassade der Münchner Residenz (Residenzstraße 3) ersetzt seit 2011 eine ältere Bodenplatte. Sie ehrt vier Polizisten, die an jener Stelle im Luddendorf-Hitler-Putsch am 9. November 1923 ihr Leben verloren, als sie sich den Nationalsozialisten bei ihrem "Marsch auf die Feldherrnhalle" entgegenstellten. Die Platte wurde bewusst gegenüber der östlichen Seite der Feldherrnhalle angebracht, die seit der Machtübernahme 1933 bis zur Befreiung Münchens am 30. April 1945 als zentrale Kultstätte eine wichtige Rolle in der NS-Propaganda spielte.
Zum 50jährigen Jubiläum der Sommerspiele entstand im Herzen des Olympiaparks 2022 der Erinnerungsort Olympia-Attentat München 1972. Das Projekt wird vom Freistaat Bayern, der Bundesrepublik Deutschland, der Landeshauptstadt München, dem Internationalen Olympischen Komitee, der Foundation for Global Sports Development und dem Deutschen Olympischen Sportbund getragen.
Im Kulturleben der Landeshauptstadt ist die IKG München bereits seit 1986 mit den von der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e.V. ausgerichteten, jährlich stattfindenden Jüdischen Kulturtagen vertreten.
Zur Landesausstellung "Siehe der Stein schreit aus der Mauer. Geschichte und Kultur der Juden in Bayern" 1988/1989 gestaltete das Haus der Bayerischen Geschichte zwei Rundgänge durch München: Der erste folgt den jüdischen Spuren in der Innenstadt von der Maxburg-Straße bis zum St.-Anna-Platz, der zweite führt durch die moderne Geschichte des jüdischen Münchens ab 1945 .
Die Idee für ein eigenes jüdisches Museum in München ging bereits auf die späten 1920er Jahre zurück, jedoch ließen sich die Pläne nicht mehr realisieren. Im Jahr 1989 gründete der Schwabinger Galerist Richard Grimm (*1945) in seinen Firmenräumen in der Maximilianstraße ein kleines Privatmuseum, das sich zu einem Geheimtipp entwickelte. Rund zwei Jahrzehnte engagierte er sich beim Freistaat, dem Bund und der Stadt vergeblich für eine professionelles Institution. Erst 2006 wurde im neu gebauten Jüdischen Kulturzentrum auf dem St. Jakobsplatz auch das Jüdische Museum München eröffnet.
Auch im Münchner Stadtmuseum wird mit der Dauerausstellung das Thema "Nationalsozialismus in München" eingehend behandelt. Kurz vor seiner Generalsanierung zeigte das Museum 2023/2024 zusammen mit dem Jüdischen Museum das Ausstellungsprojekt "München Displaced. Heimatlos nach 1945". Es widmet sich dem Schicksal der rund hunderttausend Heimatlosen, darunter viele Juden, die nach Kriegsende in München strandeten.
Das Gedenkbuch der Münchener Juden wird durch das Stadtarchiv betreut und ist online zugänglich. Es erlaubt eine umfangreiche Recherche in den Beständen der Landeshauptstadt München.
Im Jahr 2015 wurde das NS-Dokumentationszentrum auf dem Standort der ehemaligen NSDAP-Parteizentrale ("Braunes Haus") eröffnet. Träger sind die Landeshauptstadt, der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland. Mit mehrsprachigen Audioguides, Führungen sowie pädagogischen Angeboten setzt sich das NS-Dokumentationszentrum mit der historischen Rolle Münchens als "Hauptstadt der Bewegung" auseinander.
Mit dem ThemenGeschichtsPfad - Der Nationalsozialismus in München, den KulturGeschichtsPfaden der betroffenen Stadtteile sowie den Orten des Erinnerns und Gedenkens bietet das städtische Kulturreferat im Druck oder zum Download individuelle historische Rundgänge durch München an, unterstützt durch Übersichtskarten und Hörstationen für das Mobiltelefon. Die Geschichte der Zwangsarbeit in der Flachsröste Lohhof wird seit 2021 durch einen didaktischen "Weg der Erinnerung" aufgearbeitet, Träger ist das Forum Unterschleißheim. Im Frühjahr 2025 zeigte die Universitätsbibliothek der LMU München die Ausstellung "Möglichkeitssucher". Über die Entwicklung deutsch-jüdischer Kindermedien in den 1920er und 1930er Jahren. Die Kuratorinnen Julia Schweisthal und Annika Assil präsentierten Objekte aus der jüngst übernommenen Sammlung Dr. Simon Cohen (London). Die Ausstellung widmete sich der betont jüdischen Kinderkultur in Deutschland, die einer zunehmenden religiösen Entfremdung entgegenwirken und zuletzt auf ein neues Leben in Palästina vorbereiten sollte.
(Patrick Charell | Stefan W. Römmelt)
Bilder
Bevölkerung 1910
Literatur
- Alfons Schweiggert: Kafka in München. Zwischen Leuchten und Finsternis. 2. erw. Aufl. München 2024.
- Landeshauptstadt München (Hg.) / Karin Pohl u.a.: KulturGeschichtspfad 13: Bogenhausen. 4. akt. u. erw. Auflage. München 2023, S. 44f.
- Rolf Kießling: Jüdische Geschichte in Bayern. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin und Boston 2022 (= Studien zur jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern Band 11).
- Michael Brenner: Jüdisches Leben in München. Vom Testgelände der nationalsozialistischen Bewegung über die Terrorwelle der 1970er Jahre bis zum neuen Gemeindezentrum. Zur Bedeutung Münchens für die jüdische Geschichte. In: Akademie Aktuell 3 (2021), S. 24–27.
- Michael Brenner: Der lange Schatten der Revolution – Juden und Antisemiten in Hitlers München 1918 bis 1923. Berlin 2019.
- Patrick Charell: Franz Xaver Nachtmann. Eine Künstlerbiographie. In: Christoph Kürzeder (Hg.): In die Wiege gelegt. Ludwig II. - der gottgeschenkte Märchenkönig. München 2018, S. 45-53, hier: 46f.
- Brigitte Huber / Historischer Verein von Oberbayern (Hg.): Mauern, Tore, Bastionen. München und seine Befestigungen. München 2015.
- Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (Hg.): 200 Jahre Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern. München 2013.
- Landeshauptstadt München - Kulturreferat/NS-Dokumentationszentrum (Hg.) / Sabine Brantl: ThemenGeschichtsPfad [TGP]. Orte des Erinnerns und Gedenkens. Nationalsozialismus in München. 2. Aufl. München 2012.
- Jüdisches Museum München / Jutta Fleckenstein / Purin Bernhard (Hg.): Jüdisches Museum München [Museumsführer] München u.a. 2007.
- Bayerisches Wirtschaftsarchiv (Hg.) / Eva Moser: Von Bach zu Konen. Eine Unternehmensgeschichte von der Gründung bis zur Neuordnung des Unternehmens in den 1950er Jahren. München 2011.
- Kurt Bertrams: Der Kartell-Convent und seine Verbindungen. Hilden 2008.
- Angela Hager / Frank Purrmann: München. In: Wolfgang Kraus, Berndt Hamm, Meier Schwarz (Hg.): Mehr als Steine... Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. 1: Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben. Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager unter Mitarbeit von Cornelia Berger-Dittscheid, Hans-Christof Haas und Frank Purrmann. Lindenberg im Allgäu 2007, S. 360-385.
- Landeshauptstadt München (Hg.) / Karin Pohl u.a.: KulturGeschichtspfad 13: Bogenhausen. 4. akt. u. erw. Auflage. München 2023, hier S. 34-36, 44f., 51-54, 59f-61.
- Harald Seewann: Licaria München 1895-1933. Eine Verbindung deutscher Studenten jüdischen Glaubens im waffenstudentischen Spannungsfeld. In: Einst und Jetzt 52 (2007), S. 177-221.
- Stadtarchiv München (Hg.) / Andreas Heusler, Eva Ohlen: Das Jüdische Museum München. 1989 bis 2006 ein Rückblick. München 2006.
- Richard Bauer / Michael Brenner (Hg.): Jüdisches München. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München 2006.
- Münchner Stadtmuseum / Stadtarchiv München (Hg.) / Franz Schiermaier: Stadtatlas München. Karten und Modelle von 1570 bis heute. München 2003, S. 58f., 62f., 80f., 86f., 98f., 106f. mit Kartenbeilagen.
- Josef H. Biller / Hans-Peter Rasp: München Kunst & Kultur. Stadtführer und Handbuch. München 2003, S. 365f.
- Graham Dry: Krüge für München. Herstellung, Veredelung und Vertrieb. In: Münchner Stadtmuseum / Florian Dering u. Sandra Uhrig (Hg.): Das Münchner Kindl. Eine Wappenfigur geht eigene Wege. München 1999, S. 114-120.
- "Betrifft: Firmenzeichen des Kaufhauses Uhlfelder", 1938. In: Münchner Stadtmuseum / Florian Dering u. Sandra Uhrig (Hg.): Das Münchner Kindl. Eine Wappenfigur geht eigene Wege. München 1999, S. 215-241, hier 226f.
- Andreas Heusler / Tobias Weger: "Kristallnacht". Gewalt gegen die Münchner Juden im November 1938. München 1998.
- Roswitha von Bary: Herzogsdienst und Bürgerfreiheit. Verfassung und Verwaltung der Stadt München im Mittelalter. München 1997 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt München 3), S. 126 u. 181.
- Landeshauptstadt München (Hg.) / Benedikt Weyrer: München 1933-1949. Stadtrundgänge zur politischen Geschichte. München 1996.
- Manfred Döbereiner: Residenz- und Bürgerstadt – Münchens Weg zur relativen Selbstständigkeit. In: Richard Bauer (Hg.): Geschichte der Stadt München. München 1992, S. 61-96, hier: S. 92f.
- Wolfram Selig (Hg.) / Gabriele Dischinger: Synagogen und jüdische Friedhöfe in München. München 1988.
- Wolfram Selig (Hg.): Synagogen und jüdische Friedhöfe in München. München 1988.
- Museumspädagogisches Zentrum, Stadtarchiv München (Hg.) / Wolfgang Behringer: Rundgang durch das mittelalterliche München. München 1987, S. 90f.
- Johann Paul Stimmelmayer / Gabriele Dischinger u. Richard Bauer (Hg.): München um 1800. Die Häuser und Gassen der Stadt. München 1980, S. 12.
- Fridolin Solleder: München im Mittelalter. Neudruck der Ausgabe München 1938. Aalen 1962.
- Pius Dirr (Bearb.) / Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hg.): Denkmäler des Münchner Stadtrechts, Bd. 1: 1158 - 1403. München 1934 (= Bayerische Rechtsquellen 1).
- Industrie und Handelskammer München (Hg.): Münchner Stadtadreßbuch Jg. 85 (1933), Abt. III, S. 130f.
- Michael Doeberl, Otto Scheel u.a. (Hg.): Das Akademische Deutschland. Berlin 1931, Bd. 3, S. 525 u. 526 sowie Bd. 4, Tafel XXXII u. XLII.
- Kartell-Convent der Verbindungen Deutscher Studenten Jüdischen Glaubens (Hg.): K.C.-Adressbuch 1929. Berlin 1929, S. 11.
- K. statistisches Landesamt: Gemeindeverzeichnis für das Königreich Bayern. Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und dem Gebietsstand von 1911. München 1911 (= Hefte zur Statistik des Königreichs Bayern 84), S. 2.
- Carl Seitz / Max Ravizza: Plan Monumental von München (Detail: Synagoge am Maximiliansplatz). Chromolithografie, München um 1900. BSB, Mapp. XI,467 ikf.
- Carl Seitz / Max Ravizza: Plan Monumental von München (Detail: Synagoge in der Westenriederstraße). Chromolithografie, München 1864 (?). BSB, Mapp. XI,462.
- Schreiben Kurfürst Karl Albrechts (1729), dass der Weinwirt Hillebrandt, der dem Hoffaktor Wertheimer in seinem Haus die Feier des Laubhüttenfestes gestattet hat, gnadenhalber nicht mit der Hauskonfiskation, sondern nur mit 100 Dukaten zu bestrafen sei. Stadtarchiv München, DE-1992-BUR-1282.
Weiterführende Links
- Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern
- Liberale Jüdische Gemeinde München
- Jüdisches Museum München
- Gemeinde München (Alemannia Judaica)
- Gemeinde München (Alicke - Jüdische Gemeinden)
- Synagogen in München (BR - Online)
- NS-Dokumentationszentrum München
- Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e.V.
- Europäische Janausz Korczak Akademie e.V.
- Rundgang: Jüdisches Leben in München I (Haus der Bayerischen Geschichte)
- Rundgang: Jüdisches Leben in München II (Haus der Bayerischen Geschichte)
- Dauerausstellung "Nationalsozialismus in München" (Münchner Stadtmuseum)
- Ort mit Geschichte - Das Kaufhaus Uhlfelder (Münchner Stadtmuseum)
- Einträge zu "München" im Gedenkbuch (Bundesarchiv)
- Münchner Judenrecht 1315 (Haus der Bayerischen Geschichte - Jüdisches Leben in Bayern)
- Münchner Fleischordnung 1340 (Haus der Bayerischen Geschichte - Jüdisches Leben in Bayern)
- Susanne Reber: Familie von Eichthal
- Matthias Stickler: Eine untergegangene akademische Welt. Jüdische und paritätische Studentenverbindungen in Deutschland
- Verbindungsfahne des KC Licaria München (Leo Baeck Institute)
- Rosemarie Burgstaller (2020): Der Ewige Jude. Ausstellung, 1937 (Historisches Lexikon Bayerns)
- Walter Ziegler (2019): Machtergreifung in Bayern, 9. März 1933 (Historisches Lexikon Bayerns)
- München Deutsches Museum - UNRRA Durchgangslager
- München Funkkaserne - Durchgangs- und Auswanderungslager
- München-Bogenhausen - UNRRA/Jüdisches Krankenhaus
- München - Jüdische DP-Gemeinde
- München-Freimann - Jüdisches DP-Lager
- München Warner-Kaserne - Durchgangs- und Auswanderungslager
- München-Feldmoching DP-Gemeinde (Talmud Thora Schulen in Deutschland)
- München-Freimann DP-Camp (Talmud Thora Schulen in Deutschland)
- München-Lohhof: "Weg der Erinnerung" zur Zwangsarbeit in der Flachsrösterei (Forum Unterschleißheim)
- Verlegte und ausgestellte Stolpersteine in München (Stolpersteine Initiative für München e.V.)
- Andrea Neumeier / Christian Wölfel: Erste Europäische Rabbinerkonferenz tagt in München. In: BR24 online (31.05.2022)