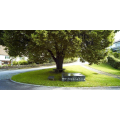Fischach war seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts bis 1805 Teil der habsburgischen Markgrafschaft Burgau. Mit dem Ziel, ihre Territorialpolitik auszubauen und ihre Einnahmequellen zu vergrößern, siedelten die Habsburger seit dem 16. Jahrhundert systematisch jüdische schutzpflichtige jüdische Grunduntertanen an. Erste Familien werden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nachweisbar. 1582 werden sechs Schutzjuden aufgezählt, 1586 regelte ein Weidevertrag die Nutzungsrechte für das Fischacher Weideland, wobei auch die jüdischen Viehhändler gegen Zahlung das gemeindliche Weideland nutzen konnten. Aufgrund religiöser Vorbehalte der katholischen Geistlichkeit und aus wirtschaftlichen Interessen kam es immer wieder zu Streit.
Die Verwüstungen im Verlauf des 30jährigen Kriegs brachten nur eine kurze Unterbrechung jüdischen Lebens in Fischach. Die Gemeinde unterstand zunächst dem Rabbinat Augsburg-Kriegshaber und wurde dann für 200 Jahre ein eigenständiges Rabbinat; der erste, namentlich leider unbekannte Rabbiner wurde 1698 in Kriegshaber beigesetzt. Die Toten der Gemeinde wurden zunächst in Burgau, dann Kriegshaber beigesetzt. Seit 1742 gab es Bemühungen, einen eigenen Friedhof anlegen zu dürfen. Aber erst 1774 konnte die Gemeinde ihren "Guten Ort" außerhalb des Ortskerns von Fischach einweihen.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten sich die Handelsbedingungen etwas gelockert, so dass eine Handelstätigkeit im Umfeld des Ortes möglich war. Ein Zugang zu den Augsburger Märkten blieb den Fischacher Juden allerdings verwehrt. Bis 1739 lebten 29 Familien als "ungläubige" Juden im Ort. Sie wurden von der Geistlichkeit mit Misstrauen beobachtet. Gegen die weltliche Grundherrschaft konnte der Ortspfarrer allerdings nichts ausrichten und vermerkte deshalb in einem Pfarrvisitationsprotokoll von 1719: "Diese Hennen legen guldene ayer". Ein dauernder Streitpunkt blieb der viel zu kleine Anteil der jüdischen Familien an der Gemeindeverwaltung. Trotz aller finanziellen Verpflichtungen waren sie von Gemeindeversammlungen ausgeschlossen. Auch die eingeschränkte Nutzung der Viehweide war ein fortwährender Klagepunkt. Die katholischen Pfarrer beschwerten sich über das "Judengesindel" und sorgten dafür, dass sie es in Fischach nie lange aushielten. Die Synagogeneinweihung von 1739 zeigt eine stabile jüdische Gemeinde. In dem Gebäude befand sich auch ein Ritualbad und die Wohnung des Vorsängers.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts zählte die jüdische Gemeinde mit 32 Familien etwa 160 bis 170 Personen. Sie waren gezwungen, weiterhin in den fünf zugeteilten Häusern zu leben, die durch Aufstockungen und Anbauten wahrscheinlich nur notdürftigen Platz boten. Zwei "Judenhäuser" (Am Judenhof 2 und 1-3) lagen neben der Synagoge und der Pfarrkirche, die anderen Häuser zwischen den Häusern der christlichen Fischacher.
Im Jahr 1807 zählte die jüdische Gemeinde 51 Familien mit 246 Personen und machte damit etwa die Hälfte der Fischacher Bevölkerung aus. Die eingeschränkten Wohnverhältnisse verbesserten sich erst nach 1805, als der Ort an Bayern fiel. Jetzt war, in sehr eingeschränkter Form, ein Kauf von Häusern möglich. Die Anzahl der Familien durfte insgesamt nicht ansteigen und ein Haus nur von jeweils einer Familie bewohnt werden. Immobilienhandel wurde jetzt ein neuer Geschäftszweig, die wirtschaftlichen Verhältnisse verbesserten sich. 1861 betrug der Anteil an der kommunalen Gewerbesteuer bereits mehr als ein Viertel. Diese gestiegene Wirtschaftskraft und die weitere Verbesserung der Lebensverhältnisse machte eine Aus- und Abwanderung aus rein wirtschaftlichen Gründen unnötig, daher wuchs die IKG Fischach als eine der wenigen ländlichen Gemeinden. 1847 lebten sogar 302 jüdische Einwohner in der Gemeinde.
Auch im 19. Jahrhundert beklagten sich die örtlichen Pfarrer immer wieder, dass die Christen an Sonn- und Feiertagen für jüdische Familien als "Schabbesgojim" arbeiten würden, und dass der Kirchenbesuch darunter leiden würde. 1843 verbot der Bürgermeister der Kultusgemeinde die feierliche Übertragung einer neuen Torarolle mit Musik, eine kleinliche Schikane.
Einen Fortschritt bedeutete 1847 der Neubau des Schul- und Rabbinatshauses (Am Judenhof 6), denn jetzt war ein staatlich anerkannter Religions- und Volksschulunterricht möglich. In der Nähe befand sich auch eine Mikwe. Bis 1880 besaß Fischach ein eigenes Rabbinat. Moses Presburger (1798 in Fischach verstorben), Raphael Philipp, Joseph Landauer und Simon Simcha Bamberger (bis 1881) waren hier als Rabbiner tätig. Anschließend wurde Fischach in das Distriktsrabbinat Ichenhausen eingegliedert.
Mit der Fischacher Laubhütte hat sich bis heute ein Zeichen des jüdischen Lebens erhalten. Der wohlhabende Kaufmann Jakob Deller gab um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Laubhütte in Auftrag. Sie besteht aus einem zerlegbaren Gerüst mit nummerierten Brettern und Balken mit einer Grundfläche von fast neun Quadratmetern und einer Höhe von 2,10 m. Alle Wände sind bemalt, die Motive sind die Stadt Jerusalem und die fünf hohen jüdischen Feste. Nach ihrer Wiederentdeckung 1935 konnte sie nach Palästina geschmuggelt und dem Nationalmuseum in Jerusalem übergeben werden.
Trotz aller Eingliederung in die politische Gemeinde und in das Vereinsleben vor allem im 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu Spannungen, die z.B. zur Gründung einer eigenen jüdischen Feuerwehr führten. Die Vereinigungen der IKG waren meist jüdisch-orthodox und zionistisch orientiert. Die jüdischen Fischacher, 1925 waren es 153 Personen, spielten auch in der Weimarer Republik eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen Leben ihres Heimatorts. Sie besaßen Geschäfte mit Eisenwaren, landwirtschaftliche Maschinen und anderen Handelprodukten, die Horn- und Kunsthornfabrik Mendle hatte überregionale Bedeutung. Trotzdem kam es bereits zu Beginn der 1930er-Jahren im gemeinsamen Vereinsleben zu Rücktritten und Austritten und zu antisemitischen Vorfällen.
Die 1933 in Fischach lebenden 127 Jüdinnen und Juden waren sehr bald dem Repressionen des neuen Regimes ausgesetzt. Der Ausschluss von allen Ortsvereinen erfolgte noch 1933. Die Boykottaufrufe gegenüber den jüdischen Geschäften verstärkten sich. Die Inhaber waren mehr und mehr gezwungen, ihr Eigentum weit unter Wert zu verkaufen. Auch die Hornwarenfabrik Mendle wurde "arisiert". Aus einem Gefühl der falschen Sicherheit heraus, "wir sind zuerst Deutsche, dann Juden", kam es zu keiner verstärkten Auswanderung.
Beim Pogrom im November 1938 blieben die Synagoge und der Friedhof zunächst unbeschädigt. Allerdings wurden die Teilnehmer des Umschulungslagers, die auf die Emigration und das Leben in Palästina vorbereitet wurden, festgenommen und in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Sie konnten aber Anfang 1939 nach Palästina auswandern. Noch 1938/39 konnte über dreißig meist junge Fischacher auswandern. Im April und im August 1942 wurden 66 jüdische Fischacher über München nach Piaski oder in das KZ Theresienstadt gebracht. Von diesen Menschen überlebte niemand.
An die Opfer erinnert ein Gedenkstein auf dem Friedhof mit der Aufschrift: "Den Opfern der Rassenverfolgung geweiht 1933-1945. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung".
Anlässlich der Ausstellung "Geschichte und Kultur der Juden in Bayern" 1988/1989 hat das Haus der Bayerischen Geschichte eine Exkursion in Mittelschwaben angelegt. Die Route beginnt in Augsburg und erschließt neun jüdische Landgemeinden (Fischach-Thannhausen-Krumbach-Fellheim-Illereichen-Altenstadt-Ichenhausen-Binswangen-Buttenwiesen). Im Jahr 1999 wurde zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde Fischach ein Gedenkstein in der Triebgasse aufgestellt. Die ehemalige Gemeinde ist auch Teil der digitalen Bavarikon-Sammlung Das jüdische Erbe Bayerisch-Schwabens. Kultur und Alltag des Landjudentums von 1560-1945, die 2025 mit einem Festakt in der Augsburger Synagoge online gegangen ist.
(Patrick Charell)
Bilder
Bevölkerung 1910
Literatur
- Cornelia Berger-Dittscheid: Fischach. In: Wolfgang Kraus, Berndt Hamm, Meier Schwarz (Hg.): Mehr als Steine... Synagogen-Gedenkband Bayern, Band 1: Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben. Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager unter Mitarbeit von Cornelia Berger-Dittscheid, Hans-Christof Haas und Frank Purrmann. Lindenberg i. Allgäu 2007, S. 440-452.
- Michael Piller: Fischach. Geschichte einer mittelschwäbischen Marktgemeinde. Weißenhorn 1981, S. 186-191, 196-208, 283-296, 357-360, 451-457.
- K. statistisches Landesamt: Gemeindeverzeichnis für das Königreich Bayern. Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und dem Gebietsstand von 1911. München 1911 (= Hefte zur Statistik des Königreichs Bayern 84), S. 279.
Weiterführende Links
- Das jüdische Erbe Bayerisch-Schwabens: Fischach (Bavarikon)
- Exkursion: Jüdische Landgemeinden in Mittelschwaben (Haus der Bayerischen Geschichte)
- Archivalien zur Geschichte der Synagogen und Gemeinden in Bayerisch Schwaben (Jüdisches Museum Augsburg Schwaben)
- Gemeinde Fischach (Alemannia Judaica)
- Gemeinde Fischach (Alicke - Jüdische Gemeinden)